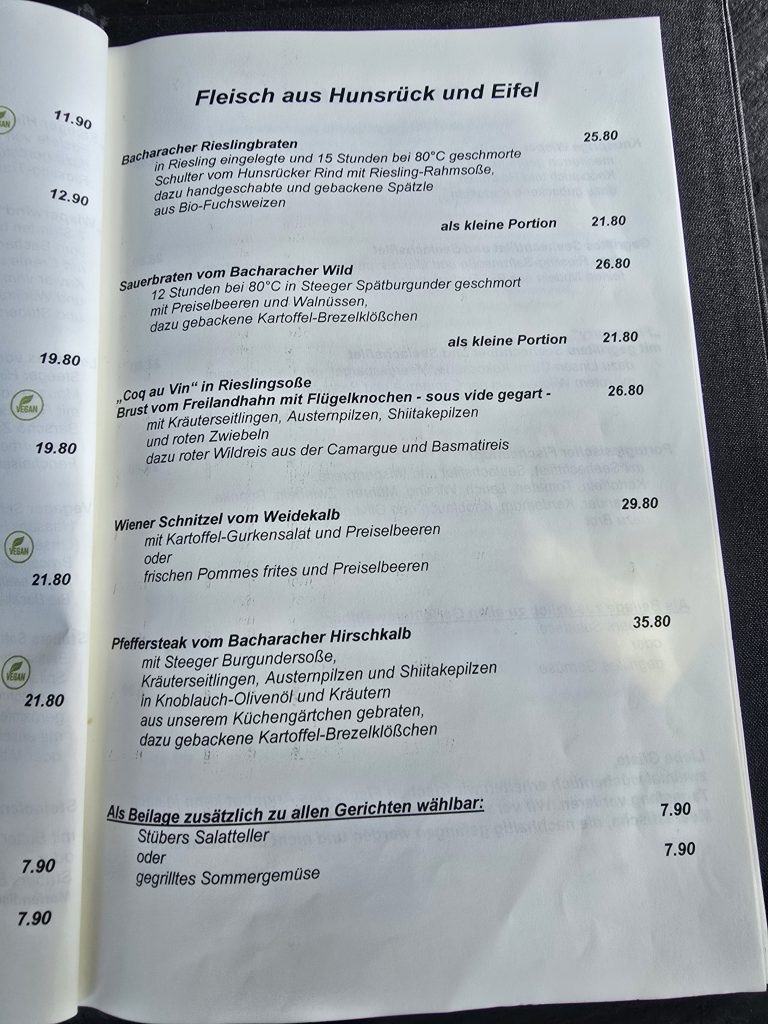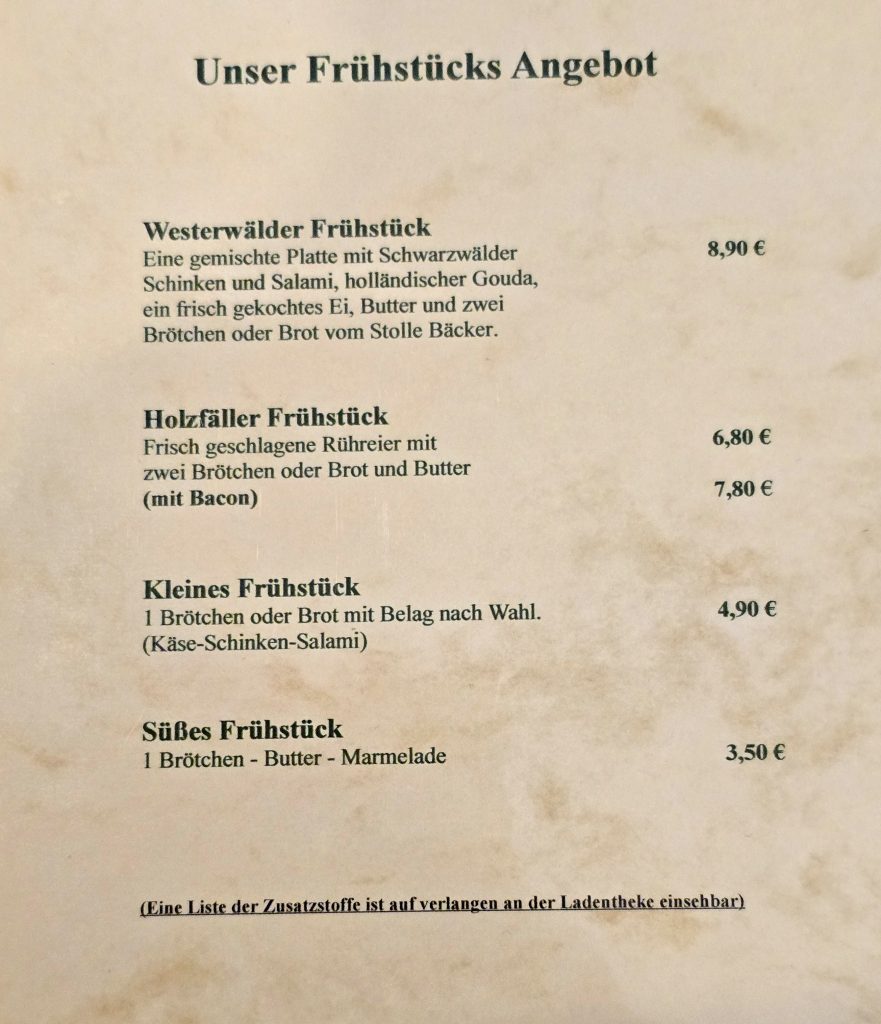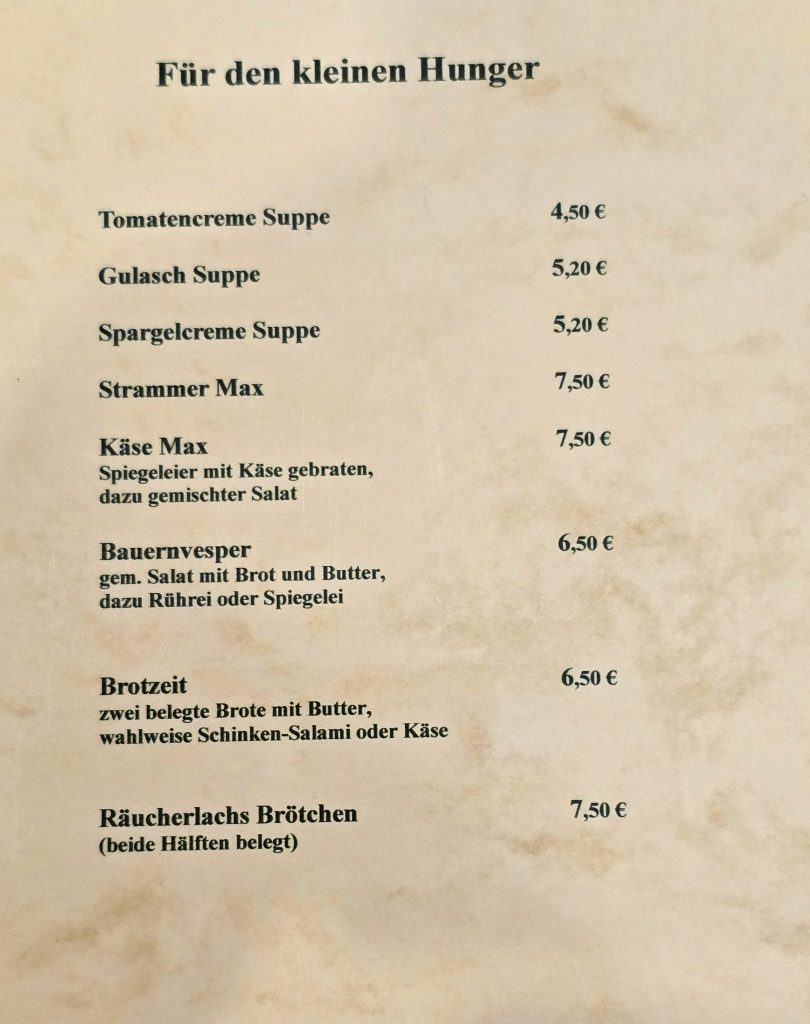Wenn der Beruf wirklich eine Berufung war, trifft dieses Adjektiv haargenau auf die examinierte Hebamme Marie-Leonie Gabriel zu. Die 23-jährige eloquente Frau vereint in sich alle Parameter, die man für diesen sehr individuellen Beruf braucht. Angefangen bei der notwendigen Empathie, gepaart mit Einsatzfreude und vor allem einem umfangreichen Fachwissen, verkörpert sie alles, was sich eine Gebärende vor, während und nach der Geburt wünscht.

Bereits als Gymnasialschülerin war ihr klar, dass sie nach dem Abitur diesen wohl ältesten Beruf der Menschheit erlernen würde. Ihr erstes Praktikum in Ehringshausen absolvierte die damals 14-Jährige und das verfestigte ihren späteren Berufswunsch. Der Kreißsaal war aufgrund ihres jugendlichen Alters für sie Tabu. Das zweite Praktikum, dass sie als Schülerin der 11. Klasse in der Uni-Klinik-Gießen machen durfte, erlaubte ihr mit Zustimmung ihrer Eltern auch den Aufenthalt im Kreißsaal. Sie erlebte „normale“ Geburten, Kaiserschnitte sowie die Betreuung schwangerer Frauen auf der Station.
Die Würfel waren gefallen und direkt nach dem Abi fing Marie mit ihrer Ausbildung im September 2021 an der Uni-Klinik Gießen an. Drei Jahre später, Ende August 2024 nahm die junge Frau mit berechtigtem Stolz ihre Examensurkunde entgegen. Bereits im Oktober trat sie ihre Stelle als examinierte Hebamme im Kreißsaal der Klinik an. Sie gehörte dem allerletzten Ausbildungsgang ohne Studium an. Auf die Berufsbezeichnung Hebamme hat das allerdings keinen Einfluss, erklärte sie.
Die Ausbildung umfasste sehr große praktische-und theoretische Blöcke. Der größte Teil der praktischen Ausbildung habe natürlich im Kreißsaal gelegen. Dazu kamen Wochenbettstation und Kinderklinik. Sie musste aber auch an gynäkologische Operationen teilnehmen. Auf zwei Externaten in der Schweiz in einem Geburtshaus sowie in einer Praxis in Löhnberg, begleitete sie freiberufliche Hebammen einige Wochen lang. Die sehr anspruchsvollen Theorieblöcke hätten es ebenfalls in sich gehabt, sagte Marie Gabriel. Allgemeine Anatomie, Mikrobiologie und Arzneimittelkunde und vor allem Hebammentätigkeit schafften die Voraussetzungen für die Praxis. Die Frage, ob sie durch ihre umfangreiche Ausbildung eine gute Hebamme geworden sei, beantwortete sie ohne Zögern mit ja. Marie kann bisher auf eine stattliche Zahl von Geburten zurückblicken. Alleine die in der Ausbildungszeit vorgeschriebenen 40 übertraf um 10 Geburten, so dass mittlerweile weit über hundert Geburten zusammenkommen.
Sie sei sich jedoch durchaus bewusst, dass gerade die Hebamme ihr ganzes Berufsleben lernen müsse. Darüber hinaus bestehe für Hebammen eine gesetzlich verankerte und nachzuweisende Fortbildungspflicht. Dies alles und noch viel mehr sei in dem sogenannten Hebammengesetz (HebG) geregelt.
Marie- Leonie Gabriel ist heute im Drei- Schicht-Betrieb im Kreißsaal der Uni-Klinik-Gießen eingesetzt. Dort nimmt sie vollumfassend die Aufgaben einer Hebamme wahr. Dazu gehöre natürlich auch die vorgeburtliche Betreuung von Schwangeren. Da sie „nur“ zu 75 Prozent in der Klinik eingesetzt wird, ermöglicht es ihr einer freiberuflichen Hebammentätigkeit nachzugehen. Das muss sie allerdings in ihrer Freizeit erledigen. Dieses Berufssplitting sei durchaus nicht ungewöhnlich und werde von vielen Kolleginnen praktiziert. „Der Arbeitgeber ist mit dieser beruflichen Selbständigkeit durchaus einverstanden, die Abrechnung erfolgt über die Krankenkasse“, so Marie. Da jede Frau Anspruch auf einen gesetzlichen Anspruch auf Hebammenbetreuung habe, gehören beispielsweise auch Beratungsgespräche oder Stillberatungen dazu.

In der Klinik stehe sie allen Frauen je nach Bedarf zur Verfügung. In ihrer freiberuflichen Tätigkeit betreue sie „ihre“ Frauen vor und nach der Geburt und dies schaffe ein lückenloses Vertrauensverhältnis, welches besonders für derart einschneidende Abläufe für Mutter und Kind von großer Wichtigkeit seien. Hausgeburten biete sie als „Freie“ jedoch nicht an. Ihre Betreuung umfasst einen Radius von 25 Kilometer um ihren Wohnsitz, was quasi ein Gebietsschutz für sie und ihre Kolleginnen ist. So kann jede Schwangere in diesem Umkreis mit ihr Verbindung aufnehmen und Kapazität vorausgesetzt-Terminabsprachen treffen. Sie habe sich auf Herborn und Umgebung spezialisiert, so dass sie den Wünschen und Bedürfnissen ihrer „Kundinnen“ aber auch ihrem Hauptarbeitgeber in vollem Umfang gerecht werde. Marie-Leonie Gabriel ist Mitglied im Deutschen Hebammenverband.
Homepage: www.hebamme-mariegabriel.de. Anschrift: Marie-Leonie Gabriel, Eberstalstraße 12, 35745 Herborn. Mobil: 0157 555 102 92. Mail: hebamme.mariegabriel@gmail.com.
sig/Foto: privat